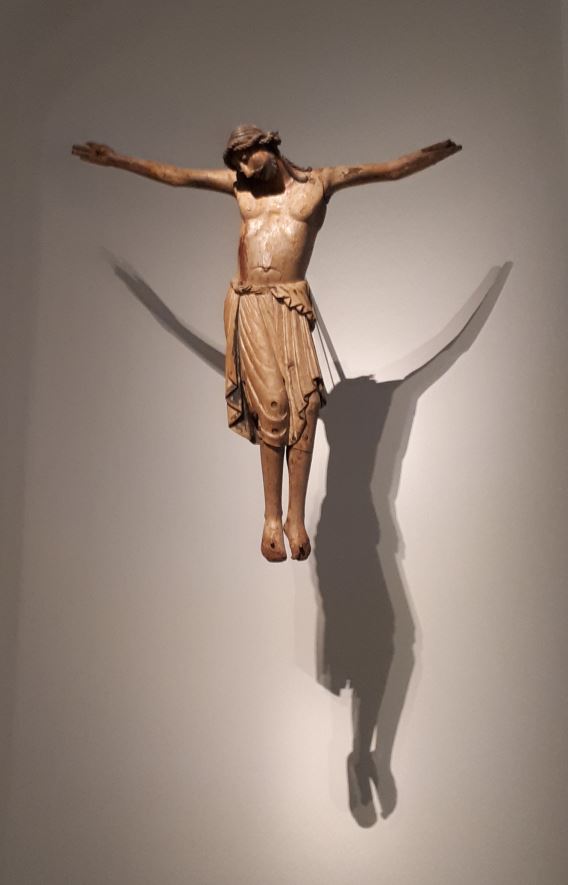Was Jacob Böhme von anderen deutschen Autoren christlicher Mystik wie MEISTER ECKHART, SEUSE oder TAULER unterscheidet, ist zum einen die visionäre Anschaulichkeit, das Unspekulative seiner Texte – zum anderen seine vulkanische Sprache, in der sich alchemistische, paracelsistische und kabbalistische Elemente mit eigenen, bildhaften Begriffsschöpfungen zu einem Sprachkunstwerk vereinen, das den geistigen Kosmos des christlichen Europa zu Beginn der Neuzeit – am Vorabend der beginnenden naturwissenschaftlichen Weltbetrachtung – auf facettenreichste Weise spiegelt und an vielen Punkten entscheidend über ihn hinausgeht.
…
Das Drehbuch für DAS GESPRÄCH wird im wesentlichen aus zwei von Jacob Böhme 1622 geschriebenen Dialogen entwickelt: „Vom übersinnlichen Leben“ und „Gespräch einer erleuchteten und einer unerleuchteten Seele“. Andere Texte aus Böhmes Werk werden hinzugezogen und in den Dialog eingefügt oder in inneren Monologen artikuliert – so z. B. Texte aus „40 Fragen von der Seele“, „Von der neuen Wiedergeburt“, „De signatura rerum“, „Mysterium magnum“, etc. – weiterhin viele im Werk verstreute „Ich“-Aussagen Böhmes. Vom Drehbuch her wird also etwas angestrebt, das man BÖHMES MEMORY nennen könnte – eine Evokation des abendländischen Geistes, wie er sich zu Beginn der Neuzeit im Kopfe eines christlichen Visionärs kristallisierte – dargestellt als klassischer Dialog, wie ihn die Geschichte des europäischen Theaters und der abendländischen Philosophie in vielen Formen und Varianten hervorgebracht hat.
Aus: Das Gespräch. Exposé für einen Spielfilm, der auf Texten von Jacob Böhme beruht. Von Ronald Steckel (1994)
Der vollständige Text zu „Das Gespräch“ kann hier gelesen werden:
XVI. MAGISCHE BLÄTTER BUCH
CIV. Jahrgang – Winter 2023/2024
Film und Theater im Jakob-Böhme-Bund (Januar | Heft 48)
EINZELBUCH, 427 Seiten, 20,00 € (zuzüglich Versandkosten) ISBN 978-3948-5941-4-5
Herausgeber: Verlag Magische Blätter – Ronnenberg | Schriftleitung: Organisation zur Umwandlung des Kinos
Bestellungen hier: kontakt@verlagmagischeblaetter.eu subject: BESTELLEN MAGISCHE BLÄTTER BUCH XVI
Gefällt mir Wird geladen …